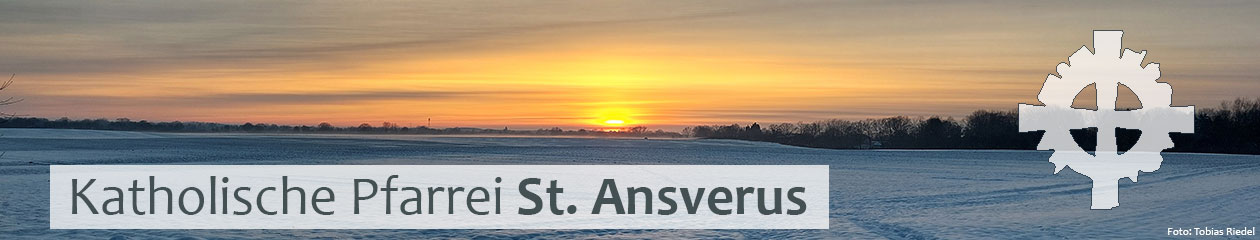von Gemeindereferentin Monika Tenambergen
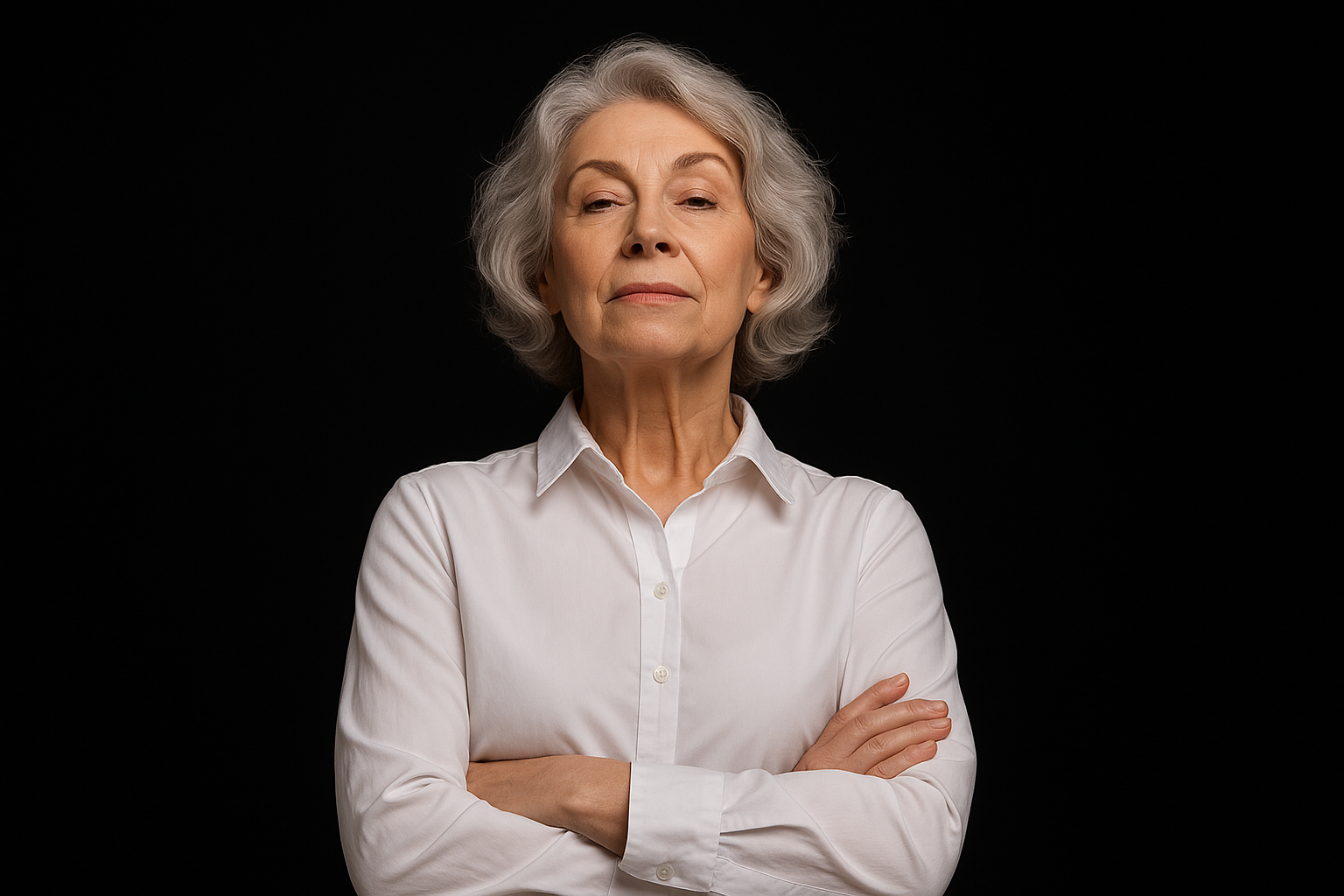
Evangelium Lk 18, 9–14
In jener Zeit 9 erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis:
10 Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten;
der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 11 Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. 12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. 13 Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! 14 Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Impuls
Dieses Beispiel vom hochmütigen Pharisäer und vom demütigen Zöllner, wie oft habe ich es schon gehört. Und natürlich wusste ich immer gleich, auf welcher Seite ich stehe: auf der des Zöllners selbstverständlich! Bis jetzt hatte ich das Beispiel so gelesen, dass Jesus mal wieder den Pharisäern einen Spiegel vorhält. Und zu denen gehöre ich ja schließlich nicht, Gott sei Dank! – Und schon bin ich in die Falle der Selbstgerechtigkeit getappt!
Bei genauem Lesen muss ich feststellen, dass Jesu Zuhörer dieses Mal nämlich nicht die Pharisäer sind. Diese Perikope schließt unmittelbar an das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter an, welches wir am vorigen Sonntag gehört haben, und da spricht Jesus ganz klar zu seinen Jüngern! Unter ihnen muss es einige gegeben haben, „die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten“ (Lk 18, 9). Und deshalb muss ich meine Perspektive auf diesen Text wechseln, denn plötzlich kann ich mich nicht mehr von dem Beispiel des Pharisäers distanzieren. Plötzlich geht es mich etwas an, als eine Jüngerin, die versucht, in der Nachfolge Jesu zu leben.
Wohl oder übel schaue ich mir also die Person des Pharisäers genauer an. Mir fällt auf, dass er sein Gebet leise spricht. Er stellt sich nicht zur Schau, sondern er spricht leise. Es ist eine Konversation zwischen ihm allein und Gott. Das finde ich zunächst einmal ganz sympathisch. Dann dankt er Gott dafür, dass er nicht auf die schiefe Bahn geraten ist. Gut so! Er fastet freiwillig zweimal die Woche. Alle Achtung! – Eine Pflicht zum Fasten gibt es nur am Jom Kippur Tag, dem Versöhnungstag. – Er gibt den zehnten Teil seines ganzen Einkommens für soziale Zwecke, zum Unterhalt von Witwen, Waisen und Leviten. Er tut was er kann, um seinen Teil zur Gerechtigkeit in seiner Gesellschaft beizusteuern. Und, auch wenn er es nicht ausdrücklich erwähnt, er hält sich an die Gebote, die Gott selbst gegeben hat. Das alles ist ihm doch zugute zu halten. Er meint es ernst mit dem Glauben und er gibt sich wahrlich Mühe, gottgefällig zu leben. Das muss man anerkennen, finde ich.
Auf der anderen Seite sehe ich den Zöllner. Er steht hinten im letzten Winkel des Tempels. Er wird nicht ohne Grund so zerknirscht sein. Seine Taten werden zwar nicht aufgezählt, aber wir wissen, Zöllner galten als Kollaborateure der römischen Besatzungsmacht, sie missbrauchten ihr Amt, betrogen und bereicherten sich an zu viel erhobenen Steuern. Sie waren vor allen Dingen auf ihren eigenen Vorteil aus, nicht auf das Gemeinwohl. Kein Wunder, dass der Zöllner in diesem Beispiel es nicht wagt, seinen Blick zum Himmel zu erheben. Und doch kommt der Zöllner in diesem Beispiel besser weg, als der Pharisäer. Warum eigentlich?
Weil es hier nicht um die Taten der beiden sehr klischeehaft dargestellten Berufsgruppen geht, sondern um eine innere Haltung. Die Lebensweise des Pharisäers ist – von außen betrachtet – absolut vorbildlich, die des Zöllners dagegen wirklich verwerflich. So etwas kann man nicht gutheißen.
Leider zerstört der Pharisäer mit einer einzigen Bemerkung das sonst so perfekt erscheinende Bild eines Gott wohlgefälligen Menschen. „Danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner dort.“ Mit dieser Bemerkung tappt er in die Falle der Selbstgerechtigkeit. Der abwertende Blick auf den Zöllner wird dem Pharisäer zum Verhängnis. Mit seiner Selbstgerechtigkeit stellt er sich letztlich an die Stelle Gottes. Von ihm erwartet er nur noch Zustimmung, nicht das Urteil selbst. Das hat er ja schon längst klar.
Der Zöllner auf der anderen Seite erkennt, dass er sich nicht selbst freisprechen kann. Er hat Gott letztlich nichts anderes zu bieten, als ein verkorkstes Leben, als leere Hände, als ein demütiges Herz und den Mut, sich in aller Ehrlichkeit so vor Gott zu zeigen. Das aber ist seine Rettung. Leere geöffnete Hände können das Geschenk der Vergebung empfangen. Ein demütiges Herz kann Gott berühren und heilen.
Meinen neuen Blick auf diesen Abschnitt des Lukas-Evangeliums unterstreicht ein Gedicht von Eugen Roth, das uns mit feinem Humor und ironischem Ton unsere eigene Schwäche für moralische Überheblichkeit vor Augen führt. Es erinnert daran, wie schnell man in die Falle der Selbstgerechtigkeit tappen kann. Achtung – sie steht überall!
Der Salto
Ein Mensch betrachtete einst näher
die Fabel von dem Pharisäer,
der Gott gedankt voll Heuchelei,
dafür, dass er kein Zöllner sei.
Gottlob! rief er in eitlem Sinn,
dass ich kein Pharisäer bin!
Eugen Roth