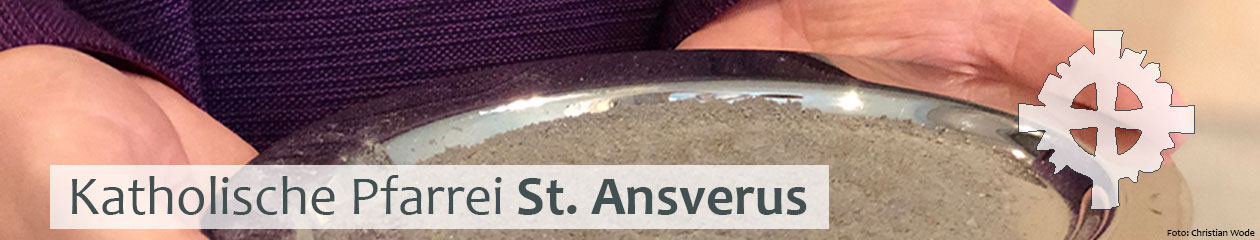Ahrensburg, St. Marien, Adolfstraße 1
Palmsonntag | Sonntag, 29. März 2026, 09:30 Uhr
Hl. Messe mit Pfr. Christoph Scieszka
Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026, 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Christoph Scieszka und den Kita- und Erstkommunion-Kindern
Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026, 19:00 Uhr
Wort-Gottes-Feier mit Diakon Tobias Riedel
Karfreitag | Freitag, 3. April 2026, 11:00 Uhr
Großhansdorf, Park Manhagen
Familienkreuzweg mit Pfr. Christoph Scieszka
Karfreitag | Freitag, 3. April 2026, 15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie mit Diakon Tobias Riedel
Karsamstag | Samstag, 4. April 2026, 12:00 Uhr
Speisesegnung mit Pfr. Christoph Scieszka
Osternacht | Samstag, 4. April 2026, 21:00 Uhr
Licht- und Wortfeier mit Diakon Tobias Riedel
Ostersonntag | Sonntag, 5. April 2026, 09:30 Uhr
Hl. Messe mit Pfr. Christoph Scieszka
Ostermontag | Montag, 6. April 2026, 09:30 Uhr
Hl. Messe mit Pfr. Christoph Scieszka
Bargteheide, St. Michael, Voßkuhlenweg 38
Palmsonntag | Samstag, 28. März 2026, 18:00 Uhr
Hl. Messe mit Pfr. Christoph Scieszka und Diakon Tobias Riedel
Ostersonntag | Sonntag, 5. April 2026, 11:30 Uhr
Hl. Messe mit Pfr. Christoph Scieszka und Diakon Tobias Riedel
Bad Oldesloe, St. Vicelin, Vicelinstr. 1
Palmsonntag | Sonntag, 29. März 2026, 12:00 Uhr (!)
Hl. Messe mit Kinderkirche mit Pfr. Christoph Scieszka, anschließend Fastenessen
Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026, 19:00 Uhr
Hl. Messe vom letzten Abendmahl mit Pfr. Christoph Scieszka
Karfreitag | Freitag, 3. April 2026, 15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie mit Pfr. Christoph Scieszka
Osternacht | Samstag, 4. April 2026, 21:00 Uhr
Osternacht mit Pfr. Christoph Scieszka
Ostermontag | Montag, 6. April 2026, 11:30 Uhr
Hl. Messe mit Pfr. Christoph Scieszka
Ratzeburg, St. Answer, Fischerstr. 1
Palmsonntag | Sonntag, 29. März 2026, 11:15 Uhr
Hl. Messe mit Pastor Stefan Krinke
Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026, 19:00 Uhr
Anbetung mit Annette Haar
Karfreitag | Freitag, 3. April 2026, 15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie mit Hubert Sieverding
Ostersonntag | Sonntag, 5. April 2026, 11:15 Uhr
Hl. Messe mit Kinderkirche mit Pastor Stefan Krinke, anschließend Osterfrühstück
Ostermontag | Montag, 6. April 2026, 11:15 Uhr
Hl. Messe mit Pastor Stefan Krinke
Mölln, Heilig Kreuz, Hempschört 34
Palmsonntag | Samstag, 28. März 2026, 18:00 Uhr
Hl. Messe mit Pastor Stefan Krinke
Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026, 19:30 Uhr
Wort-Gottes-Feier mit Waltraud Becker, anschließend stille Anbetung
Karfreitag | Freitag, 3. April 2026, 15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie mit Lydia Kunert
Karsamstag | Samstag, 4. April 2026, 11:00 Uhr
Speisesegnung mit Pastor Stefan Krinke
Osternacht | Samstag, 4. April 2026, 21:00 Uhr
mit Pastor Stefan Krinke
Ostermontag | Montag, 6. April 2026, 09:30 Uhr
Hl. Messe mit Pastor Stefan Krinke, anschließend Osterfrühstück
Trittau, St. Marien in der Martin-Luther-Kirche, Kirchenstraße 15
Palmsonntag | Sonntag, 29. März 2026, 11:00 Uhr
Ev. Gottesdienst mit Pastorin Johanna Haberer und dem Posaunenchor Trittau
Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026, 19:00 Uhr
Hl. Messe vom letzten Abendmahl mit Pastor Stefan Krinke
Karfreitag | Freitag, 3. April 2026, 15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie mit Pastor Stefan Krinke
Ostersonntag | Sonntag, 5. April 2026, 09:00 Uhr
Hl. Messe mit Pastor Stefan Krinke