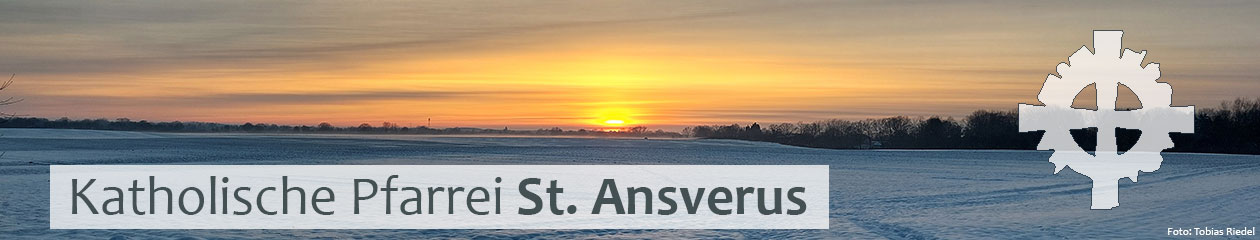Predigt von Diakon Tobias Riedel, gehalten am 1. März 2025 in St. Michael Bargteheide sowie am 2. März 2025 in St. Marien Ahrensburg und St. Vicelin Bad Oldesloe
Liebe Schwestern und liebe Brüder!
Seit über zwei Wochen wird Papst Franziskus nun schon im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Viele Menschen – auch ich – wünschen ihm von Herzen eine baldige Genesung!
In den letzten Tagen habe ich viel über das bisherige Pontifikat von Franziskus nachgedacht: Was ist ihm wichtig? Was hat er mir persönlich, der Kirche, der Welt ins Stammbuch geschrieben? Welche Akzente hat er gesetzt? Diese Predigt soll kein verfrühter Nachruf sein. Doch ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt für eine Vergewisserung – damit wir Papst Franziskus heute unterstützen und seine Anliegen morgen fortführen können.
Franziskus hat in seinem Pontifikat meines Erachtens vor allem drei Schwerpunkte gesetzt: Erstens Evangelisierung, zweitens Synodalität und drittens die Bewahrung der Schöpfung, eng verknüpft mit der Frage nach Gerechtigkeit. Alle drei Themen sind von höchster Relevanz, sie in einer einzigen Predigt zu behandeln würde den Rahmen jedoch sprengen. Deshalb möchte ich mich heute auf das Thema ‚Evangelisierung’ konzentrieren – um die beiden anderen Themen wird es demnächst gehen.
Zur Evangelisierung: Es ist unser aller Auftrag, Menschen für Christus zu begeistern. Doch die messbaren Erfolge der letzten Jahrzehnte sind, zumindest in Europa und Nordamerika, trotz noch nie dagewesener personeller und finanzieller Anstrengungen bescheiden. Die Ortskirchen schrumpfen, sind strukturell überaltert, sind in der Krise. Woran liegt das?
In seinem apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ aus dem Jahr 2013 erinnert uns Papst Franziskus an eine erste Grundvoraussetzung für Evangelisierung: Freude am Glauben. Um es mit den Worten des Heiligen Augustinus zu sagen: „Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden.“ Könnte es sein, dass unsere Verkündigung auf so wenig Resonanz trifft, weil uns selbst die Begeisterung für den Glauben abhandengekommen ist? Auf jeden Fall sollten wir uns bemühen, das Feuer immer wieder neu zu entfachen. Dafür gibt es kein Patentrezept – ein wichtiger Schlüssel ist meiner Meinung nach aber, dass wir uns über unseren Glauben austauschen. Wir sprechen in unseren Gemeinden alles Mögliche – aber sprechen wir auch über die Hoffnung, die uns erfüllt?[1] Selten, zu selten, fürchte ich! Dabei ist dieser Austausch wichtig, denn wir stärken uns so gegenseitig im Glauben. Deshalb sind etwa die Bibel- und Hauskreise in unseren Gemeinden so kostbar: Hier können wir die Erfahrung machen, dass wir nicht allein, sondern gemeinsam als Jünger Jesu unterwegs sind.
Hinzu kommt ein zweiter Aspekt: Wenn wir anfingen, uns in unseren Gemeinden über den Glauben auszutauschen, würden wir unsere Sprachfähigkeit verbessern. Sprachfähigkeit in Glaubensfragen aber ist eine weitere Voraussetzung für gelingende Evangelisierung. Machen wir die Probe aufs Exempel: Wer von uns wäre aus dem Stand in der Lage, einem fragenden Zeitgenossen zu erklären, weshalb er oder sie – beispielsweise – an ein Leben nach dem Tod glaubt? Wir glauben es, hoffentlich,[2] aber können wir es plausibel machen? Ich denke dabei nicht nur an die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die qua Beruf sprachfähig sein sollten, sondern an uns alle – denn Evangelisierung lässt sich nicht ans Hauptamt delegieren, sie geht uns alle an.
Eine dritte Voraussetzung dafür, dass der Funke des Glaubens überspringen kann, ist Glaubwürdigkeit. Persönliche Glaubwürdigkeit ist ein Auftrag für jeden Christen. Es gilt, das eigene Leben immer wieder auf Jesus hin auszurichten, ihm ähnlich zu werden und so das Evangelium glaubhaft zu leben. Die Fastenzeit, die am Mittwoch beginnt, lädt uns dazu ein. Darüber hinaus ist Glaubwürdigkeit auch ein Auftrag für die Kirche als Institution – doch ihre Glaubwürdigkeit ist durch allerlei Finanzskandale, vor allem aber durch die zahlreichen Fälle von sexualisierter Gewalt und geistlichem Missbrauch – auch und vor allem durch Kleriker – in den letzten Jahrzehnten nachhaltig beschädigt, wenn nicht gar zerstört worden. Wer will es Zeitgenossen verdenken, wenn sie das Evangelium mit Skepsis aufnehmen, wenn diese Botschaft der Liebe im Schutzraum der Kirche so sehr mit Füßen getreten worden ist? Für die Kirche ergibt sich aus diesem Fiasko – ganz im Sinne von Papst Franziskus – ein bleibender Auftrag: konsequente Aufarbeitung, konsequente Prävention und konsequente Veränderung der Machtstrukturen, die diese Verbrechen begünstigt haben. Der Synodale Weg in Deutschland und weltweit kann dabei nun ein Anfang sein. Es wird Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis die Menschen der Kirche – vielleicht – wieder Vertrauen schenken.
Doch neben mangelnder Freude am Glauben, mangelnder Sprachfähigkeit und mangelnder Glaubwürdigkeit gibt es noch einen vierten Faktor, der die Evangelisierung erschwert, wenn nicht gar unmöglich macht: Jahrzehntelang galt, dass der Mensch „unheilbar religiös“ sei. Karl Rahner etwa ging davon aus, dass im Laufe seines Lebens früher oder später jeder Mensch die Frage nach Gott stellen werde – die Suche nach Gott gehöre zum Menschsein dazu. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich diese These empirisch nicht belegen lässt. Immer mehr Menschen heute, so formuliert es der katholische Theologe Jan Loffeld[3], kommen gut durchs Leben, ohne die Frage nach Gott überhaupt zu stellen. Angesichts einer solchen religiösen Indifferenz wachsender Bevölkerungsgruppen laufen alle christlichen Antwortversuche auf die ‚großen Fragen‘ in der Tradition Immanuel Kants notwendigerweise ins Leere. „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?“ Wer sich für Fragen wie diese nicht interessiert, interessiert sich erst recht nicht für die Antworten, die Juden und Christen in über dreitausend Jahren entdecken durften.
Es scheint also realistisch, davon auszugehen, dass die Zahl der Jünger Jesu in Europa und Nordamerika in den nächsten Jahrzehnten weiter abnehmen wird. Doch das sollte uns nicht lähmen – und ändert nichts an unserem Auftrag: Wir sind eingeladen, die Freude am Glauben immer wieder neu zu entdecken. Wir sind aufgefordert, immer wieder unsere Sprachfähigkeit in Glaubensfragen zu verbessern. Und wir sind aufgerufen, uns um Glaubwürdigkeit zu bemühen, indem wir uns immer wieder an Jesus orientieren. Dann kann der Funke des Glaubens auch in Zukunft überspringen – schon ein einziger Mensch, der durch mein oder dein Engagement den Glauben für sich entdeckt, ist jede Mühe wert.
Amen.
[1] vgl. 1 Petr 3,15
[2] vgl. 1 Kor 15,12
[3] vgl. Jan Loffeld: Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz. Herder 2024.